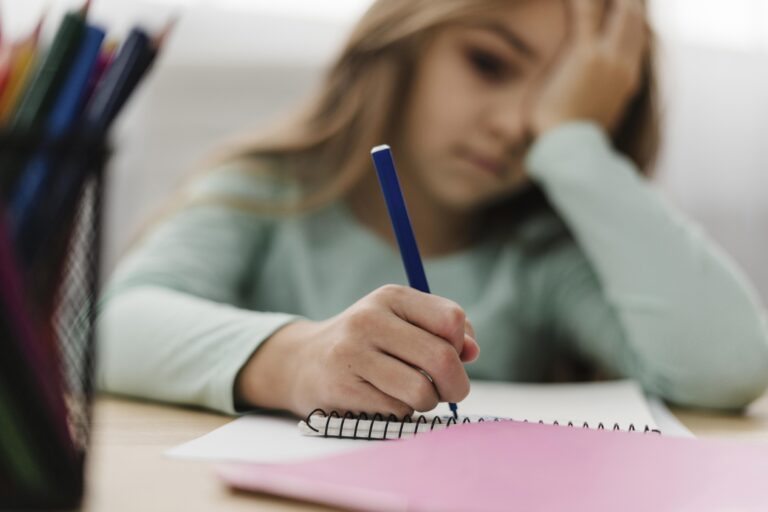Das Leben ist tödlich
Von der Angst vor dem Tod und den möglichen Konsequenzen seiner Verleugnung
Einer meiner Freunde sagte einmal zu mir: “Das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die sicher mit dem Tod endet.” Ich habe über seinen Scherz gelacht, und gleichzeitig gedacht (auch wenn das Leben natürlich keine Krankheit ist) erscheint seine Aussage rein logisch betrachtet als richtig. Definitiv ist das Leben tödlich – denn es ist endlich, und am Ende des Lebens steht der Tod. Oder wie Rainer Maria Rilke es in seinem “Schlussstück” ausdrückte:
Ein Erklärungsversuch
Das ist nicht neu. Wir alle wissen es. Wir alle erleben es. Spätestens dann, wenn ein von uns geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wird, und eine Lücke hinterlässt, die sich nie wieder schließt. Wir alle wissen in unserem Herzen, dass wir im Leben angesichts des Todes alle gleich sind, und alle dasselbe Ende teilen. Nichts davon hat sich geändert.
Aber gleichzeitig hat sich alles geändert – durch die Pandemie, die die Welt in Schrecken versetzt, und täglich die Nachrichten füllt. Aber was genau hat das verändert? Ich stelle mir diese Frage schon länger und versuche hier nach Antworten zu suchen. Diese stellen keine Wahrheit dar, sondern meine Hypothese, die der ein oder andere teilen mag – oder auch nicht.
Der ungeladene Gast
Ich habe den Eindruck, was sich vor allem geändert hat, ist unser Blick auf den Tod. Man kann nicht sagen, dass er zuvor unser Freund war. Er bringt Schmerz und Leid, kommt unangemeldet und unerwartet als ungeladener Gast und nimmt sich, was er will.
Aber er schien Teil des Lebens und Schicksals, zu sein, und wenn auch widerwillig war er ein Bestandteil des Lebens, der dazu gehört. Oder um es anders auszudrücken, ohne den Tod gäbe es in unserer polaren Welt auch kein Leben. Und angesichts des Todes kann man das Leben mehr genießen und schätzen lernen. Denn keiner weiß, ob es nicht morgen schon vorbei ist. Also lasst uns feiern – heute!
Den Tod tot schweigen
Wenn man den allgemeinen Trend in der Gesellschaft in den letzten Jahren betrachtet, scheint der Tod an Bedeutung zu verlieren. Nicht, dass er seltener zu Besuch kommt. Aber es wird anders über ihn geredet. Am liebsten redet man eigentlich gar nicht über ihn. Am liebsten schweigt man ihn tot.
Der Tod erscheint dadurch weit weg. Er betrifft andere, stellt keine akute Gefahr dar, wirkt nicht als präsente Bedrohung, ist für irgendwen und irgendwann, und gedanklich sehr weit weg.
So hat auch das Altern, das uns den Tod näher bringt, und mehr ins Bewusstsein ruft heutzutage einen wirklich üblen Ruf. Keiner will es. Man zurrt und spritzt es weg, operiert es um, retuschiert es auf Fotos, trainiert es ab, entfernt die Alten aus den Firmen und schiebt sie aus den Häusern in Heime, wo sie unter sich sind und nicht in den Augen brennen. Natürlich ist das sehr überspitzt beschrieben, und viele sehen und leben es Gott sei Dank anders. Aber der Trend und Zeitgeist scheint in diese Richtung zu gehen.
Die Welt als unsicherer Ort
Und dann Corona. Und seither klatschen uns die Presse und die Nachrichtensprecher täglich den Tod ins Gesicht. Die Zahl derer, für die alle Hoffnung zu spät kommt flimmert über den Bildschirm, Leichenberge in Bergamo rufen Horrorszenarien in unseren Köpfen hervor, Trauern am Grab mit Ritual und Feier und Zeit für den Abschied werden verboten, Kranke hinter Krankenhausmauern isoliert – jeder stirbt für sich alleine!
Und das Bild des Gevatter Tod steht plötzlich bedrohlich über dem täglichen Leben mit der Sense über dem Kopf erhoben, bereit jederzeit niederzufahren. Und die Welt wird zum unsicheren Ort, in der wir uns nicht verstecken können, denn der Feind ist unsichtbar, lauert überall, und unsere besten Freunde und geliebten Menschen werden zur potenziellen Bedrohung unseres Lebens, und wir für ihres, und zum Komplizen des Todes. Überläufer sozusagen.
Nichts Neues unter der Sonne
Wobei auch die Unsicherheit in der Welt nicht wirklich neu ist. Es gab auch vor Corona unzählige Viren und andere Krankheitserreger, die uns töten könnten. Und eine Vielzahl davon kennen wir vielleicht noch nicht einmal. Und alle Viren mutieren – ständig – denn das haben Viren als Schutzmechanismus eingebaut. Einige Viren, die so unterwegs sind, sind unter Umständen sogar tödlicher als Corona. Und auch vor Corona konnte man sich über andere Menschen anstecken. Und auch vor Corona gab es Tote – ca. 2580 täglich in Deutschland*. Nur hat über die niemand gesprochen und berichtet.
Und wir haben ein Immunsystem, das uns glücklicherweise mit auf den Weg gegeben wurde, das uns schützen kann und in den meisten Fällen brav und leise seine Arbeit tut, entweder eine Ansteckung zu verhindern, oder zu helfen eine Krankheit zu durchleben. Aber eben in manchen Fällen auch nicht. In manchen Fällen ist die Zeit der Zeiten da – die Stunde des Todes.
Unsicher war schon immer, wann er kommt, der Tod. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht auch erst in 40 Jahren. Manche treffen ihn jung und manche hochbetagt. Manche gesund und fit, manche gebrechlich und krank. Alle mit demselben Resultat, dass er uns mitnimmt. Wohin das wissen wir nicht.
Diese Unsicherheiten gab es schon immer. Nur waren sie uns nicht so bewusst wie just in dieser Zeit. Durch täglich beängstigende Nachrichten, durch steigende Zahlen, Massentests, durch Masken wie Maulkörben über dem Gesicht, durch Fremde um uns herum, die wir ohne Maske nicht wiedererkennen würden, durch den misstrauischen Blick auf den anderen, der Krankheitsüberträger sein könnte, und durch den Mangel an Ablenkung, mit dem wir über Nacht konfrontiert waren. Wer denkt schon an den Tod, wenn man lustig mit Freunden beim Grillen sitzt, mit Oma und Opa im Garten spielt, ein Sommerfest feiert, sich im Kino berieseln lässt oder einen fröhlichen Plausch mit dem Nachbarn wagt? Und wer hatte schon Zeit über ihn nachzudenken?
Trennung und Verlust
Und niemand will mehr ins Krankenhaus, denn da könnte man sterben. Und niemand will mehr ins Altenheim, denn da könnte man sterben. Und social distancing ist gut, denn es verhindert das Sterben – vielleicht. Und zu den Eltern will auch niemand mehr, denn dann könnten die sterben. Und Omi und Opi erst. Und damit wird die Welt zum noch unsichereren Ort – ein Ort der Isolation, des emotionalen Abstands, der Trennung der Familien, der Trennung der Meinungen, des Verlustes von Berührungen, des Verlustes der Spontanität (“nein Schatz, du solltest nicht einfach auf Oma zurennen und sie umarmen” , “kann ich meine Freundin jetzt umarmen, oder hat sie Angst und will das nicht?”.….).
Und plötzlich ist das Leben wie in Warteschlaufe. Später können wir ja wieder tanzen und lachen und feiern und uns in die Arme fallen: Wann? Ja, weiß nicht, irgendwann – vielleicht.
Und der einzige der tanzt ist der Tod – vor unserem inneren Auge. Und dann wird auf einmal der zum Hauptakteur, den wir vorher noch nicht einmal auf die Bühne lassen wollten. Und wir sind den Umgang mit ihm nicht gewöhnt, weil er bisher in der letzten Reihe saß. Und die Schöne – das Leben – liegt im Dornröschenschlaf während der scheinbare Bösewicht seinen Auftritt voll auszukosten scheint.
Mir scheint die Polarität zwischen Tod und Leben hat sich einerseits verschärft. Je mehr uns der Tod ins Gesicht springt, umso mehr hängen wir am Leben. Umso mehr fürchten wir den Verlust des Lebens. Umso weniger Zeit denken wir zu haben.
Andererseits ist es aber auch so, dass die Intensität des Lebens zu leiden scheint. Mir kommt es ein wenig so vor, als sei das Leben in der Warteschlange, die sich erst wieder weiterzubewegen wagt, wenn der Tod wieder verschwindet.
Aber wo soll er denn hin? Er kann sich ja nicht selber töten. Er ist nun mal eine unausweichliche Konsequenz des Lebens, an der keiner vorbeikommt. Er ist nun mal da. Er tut, was er tut, weil er es tun muss, und vielleicht ist er ja auch ganz anders als wir ihn uns vorstellen.
Eine versteckte Chance?
Ich glaube in all dem steckt eine versteckte Chance, den Ruf des Todes wieder reinzuwaschen, und das Leben zu reanimieren. Nicht, dass ich mir oder irgend jemand anderem den Tod in irgendeiner Weise wünsche. Er macht Angst, der Tod, weil wir so wenig über ihn wissen, und unsere Vorstellung von ihm bewertend und vielleicht einseitig ist, weil wir keinen Einblick haben. Und er schmerzt. Und es ist Arbeit, sich mit ihm anzufreunden. Und schwer.
Als Psychotherapeutin habe ich jedoch von manchen meiner Klienten/innen gelernt, dass der Tod auch ganz andere Seiten haben kann. Dass er Mut macht, intensiver zu leben, solange das Leben währt. Dass er sich verändert, wenn man ihn akzeptiert. Dass er aufrüttelt, und ein guter Ratgeber sein kann, wie wir das Leben, das uns bleibt am besten gestalten können. Und dass er manchmal Geschenke der Sorglosigkeit, der Lebendigkeit und der Hoffnung überreicht. Gerade weil wir nicht wissen, wann er kommt. Und gerade, weil er da ist.
Egal wie sehr sich die Gesellschaft und wir uns wünschen, er würde von der Bildfläche verschwinden, und wie fortschrittlich die Medizin noch werden wird – der Tod lässt sich kein Schnippchen schlagen. Wir können ihn ausschließen, verschweigen, vermeiden und verleumden. Das ist legitim. Mir scheint jedoch, dadurch wird sein Schatten nur größer und er wird zum Feind statt zum Begleiter, der vielleicht auch den ein oder anderen Zaubertrick in der Tasche hat, und uns zu überraschen weiß. Er hilft an diesem unsicheren Ort, an dem wir leben, Vertrauen zu üben, Dankbarkeit zu empfinden, Mut zu lernen und über uns selbst hinauszuwachsen. Und dann lernen wir das Leben zu leben – Jetzt!
Quelle: www.statista.de, Durchschnitt 2015 – 2020